Soweit meine gesundheitliche Situation es zulässt, plane ich für den Herbst den Start einer Podcast-Reihe über den Römerbrief. Man könnte denken, dass ich damit Eulen nach Athen trage. Gibt es nicht schon Auslegungen zu diesem Brief wie Sand am Meer? Warum ein paar weitere Sandkörner hinzufügen? Ich meine, es gibt gute Gründe. Ich sehe einiges an dem zu ergänzen, was so im Umlauf ist.
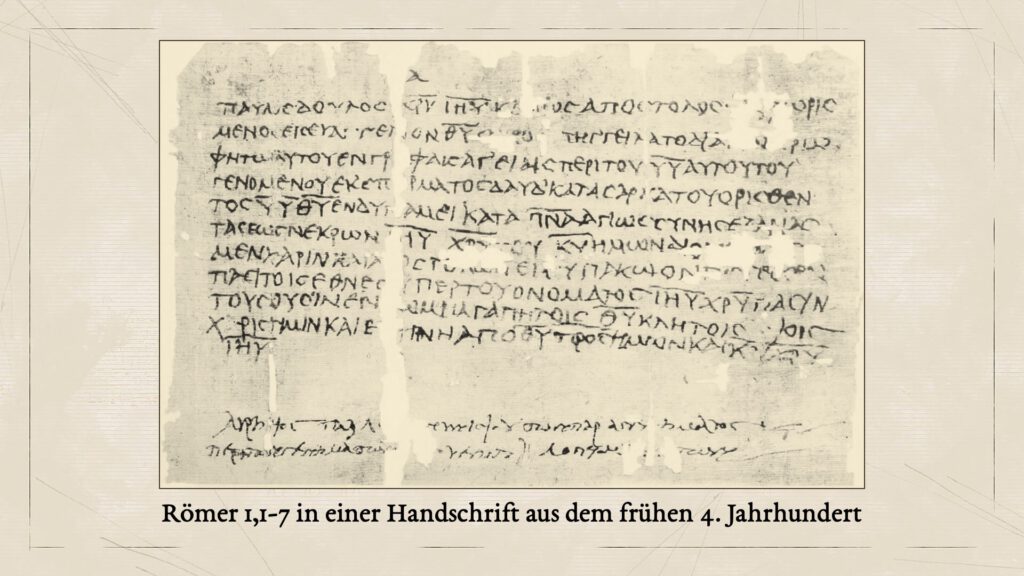
In einer Folge des Podcasts „Das Wort und das Fleisch“ unterhalten Thorsten Dietz und Martin Hünerhoff sich über „Das Relevanzproblem der Theologie“. Sie beschreiben eine Entwicklung, bei der die akademische Theologie sich zunächst vom kirchlichen Leben abspaltete und sich ihre eigene Welt schuf. Dann nahm mit der Zeit ihre Außenwirkung immer mehr ab. Was Theologen schreiben, interessiert immer weniger Leute, und die Theologie hat sich immer weiter spezialisiert, bis vieles nicht nur für Laien unverständlich geworden ist. „Normalfall ist, dass Theologie-Professoren ihre Kolleginnen und Kollegen oft nicht verstehen“, so Thorsten Dietz. Fazit: Es wird geschrieben, weil es zum Job gehört — „egal, ob’s gelesen wird. Es lesen dann die Doktoranden und die Kollegen, die da drin zitiert werden“. Und: „Im Moment haben wir eine staatlich superfinanzierte wissenschaftliche Theologie für die 0,0001 Prozent, die das feiern.“ Das gilt leider auch für manches, was zum Römerbrief veröffentlicht wird. Die Fachleute finden starke Sachen raus, aber die Leute erfahren nichts davon, und wenn sie es in die Hand bekämen, könnten sie damit wenig anfangen.
Meine Liebe zum Römerbrief begann vor fast 40 Jahren. Ich war junger Dozent an einer theologischen Ausbildungsstätte und hielt meine erste Vorlesung über diesen Brief. Vieles, was ich damals gelehrt habe, kann ich heute immer noch vertreten. Doch in den vier Jahrzehnten, die seither vergangen sind, ist nicht nur viel Wasser den Rhein hinuntergeflossen, sondern auch viel neue Erkenntnis in die Studierstuben von Neutestamentlern. Leider zirkuliert das meiste davon im akademischen Revier, wenn es nicht gar wieder versickert ist. Nur wenig fließt hinaus ins Land, um dort zu bewässern und fruchtbar zu machen. Jedenfalls finde ich in dem, was in frommen Kreisen im Gespräch ist, nur wenig davon wieder.
Sicher gibt es Christen, die es für eine Verschonung halten, wenn in der Uni bleibt, was in der Uni passiert. Manchmal haben sie recht. Bei manchem würde auch ich sagen, das muss sich nicht rumsprechen. Aber es gibt auch viel Wertvolles. Um nur ein Beispiel zu nennen: Eine enorme Fleißarbeit wurde darauf verwendet, archäologische Funde, Inschriften, Papyri, Münzen und andere Relikte der Antike auszuwerten. Wir wissen heute sehr viel mehr über das Leben im alten Rom, über die Situation der Christen, wo und wie sie wohnten, aus welchen Milieus sie stammten, welchen Einflüssen sie ausgesetzt waren und was ihr Glaube für sie im alltäglichen Lebensvollzug bedeutete. Dadurch ließe sich mehr Tiefenschärfe für das Verständnis des Römerbriefs gewinnen, wenn es bekannt würde. Aber es wird wenig bekannt, und so wird der Römerbrief weiter so gelesen, als ob seit Martin Luther nichts passiert wäre.
Thorsten Dietz und Martin Hünerhoff zitieren mehrfach Steve Jobs. In einer Zeit, in der Computer nur etwas für eine kleine Minderheit von Nerds waren, kam er auf die Idee, man müsse etwas machen „for the rest of us“ (für uns übrigen). Daraus entstanden Macs, iPhones, iPads und mehr. So bräuchte es auch eine Aufbereitung wissenschaftlicher Theologie „for the rest of us“. Eins meiner Motive für die geplante Podcast-Reihe ist, dazu beim Römerbrief etwas beizutragen, weil ich ihn sehr liebe und weil es auch nach 2000 Jahren in ihm immer noch Neues zu entdecken gibt.