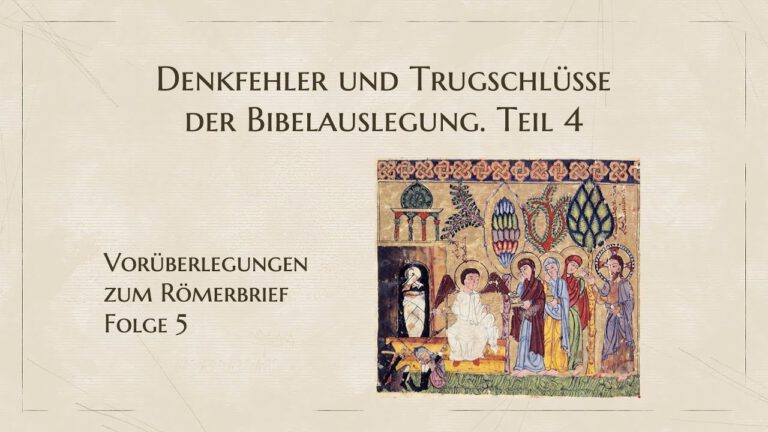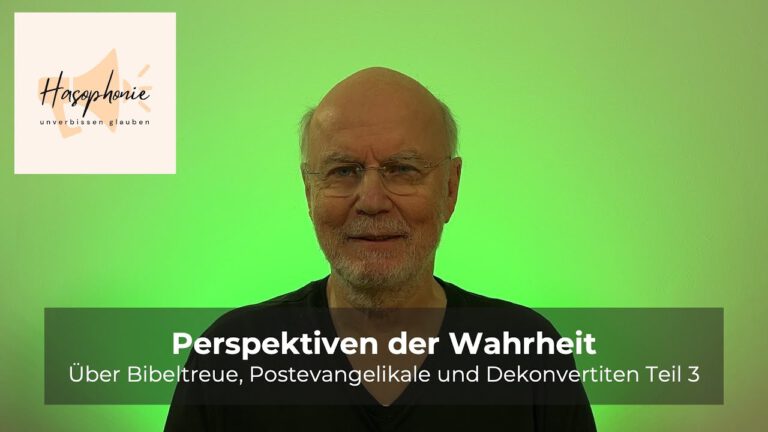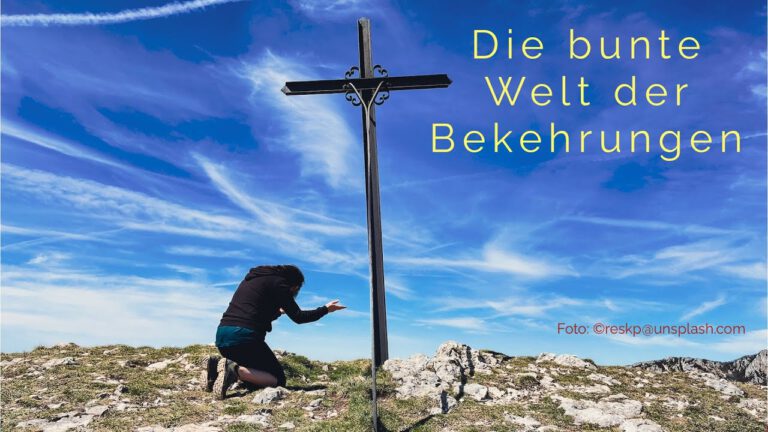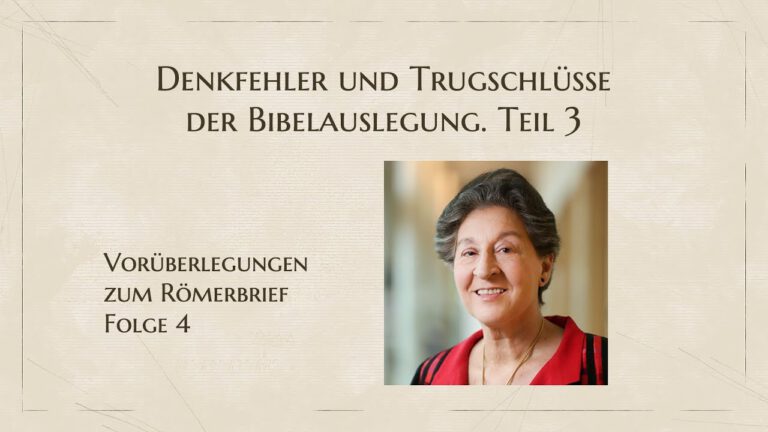Als Jesus und seine Jünger einem blindgeborenen Mann begegnen, fragen die Jünger sofort, wessen Schuld es ist, dass es diesem Mann so geht. Diese Reaktion der Jünger ist ein typisch menschliches Phänomen — bis heute. Unter dem Begriff „Gerechte-Welt-Glauben“ ist es in den letzten Jahrzehnten von der Sozialpsychologie intensiv erforscht worden. Und da gerade auch wir Christen dafür anfällig sind, lohnt es sich, sich damit zu beschäftigen. Die oft unbewusste Erwartung, dass es in der Welt gerecht zugeht, führt paradoxerweise dazu, dass wir anderen und uns selbst oft Unrecht tun. Wenn wir diese Mechanismen durchschauen, können wir mit uns und anderen besser umgehen.
Verwendete Literatur:
Melvin Lerner: The Belief in a Just World. A Fundamental Delusion. Springer Verlag 1980
Jürgen Maes: Die Geschichte der Gerechte-Welt-Forschung. Eine Entwicklung in acht Stufen?. GiP-Bericht Nr. 17, 1998
Hein F. M. Lodewijkx u. a.: In a Violent World a Just World Makes Sense. The Case of “Senseless Violence” in The Netherlands. Social Justice Research 14(1), 2001, S. 79-94
Lisa M. Diamond und Angela M. Hicks: “It’s the economy, honey!”. Couples’ blame attributions during the 2007–2009 economic crisis. Personal Relations 19, 2012, S. 586-600
Jack Deere: Surprised by the Power of the Spirit. Discovering How God Speaks and Heals Today. Zondervan 2010
Fragen zum Nachdenken oder für ein Gespräch:
- In welchen Situationen hast du dir selbst schon die Schuld gegeben für etwas, was schief gelaufen ist? War das angemessen oder ein falsches Schuldgefühl?
- Macht es für dich einen Unterschied, ob das Schicksal eines anderen unverdient oder selbst verursacht ist? Warum?